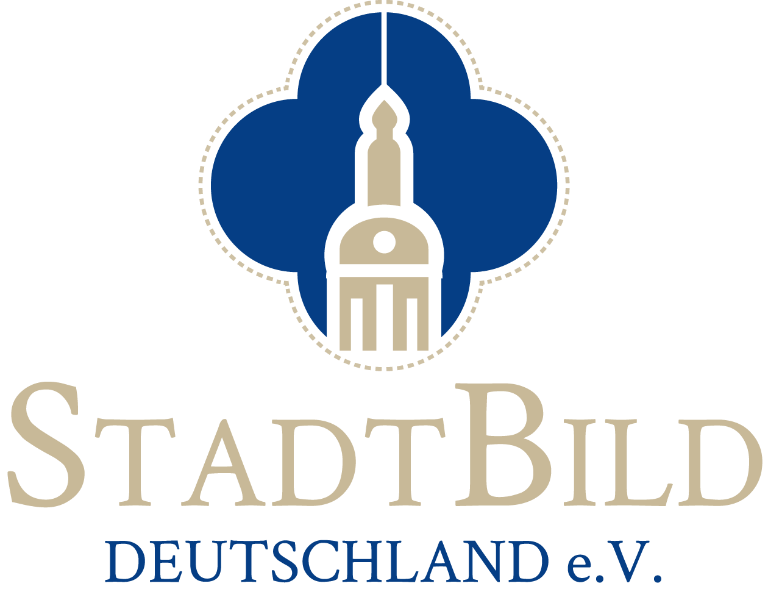Es waren nicht nur die kriegszerstörten deutschen Städte, in denen die Trümmerlandschaft zum willkommenen Vorwand geriet, eine jahrhundertealte Stadtbaukultur beiseite zu räumen. Auch nicht oder wenig Zerstörtes in Stadt und Land galt als hinderlich und überholt in einem Zeitalter veräußerlichter Komfortansprüche und ignoranter Gleichgültigkeit gegenüber der gebauten Historie. Ein jeder kann sich davon überzeugen, dass nach gut sechzig Jahren oftmals nur noch vage auszumachen ist, wie weit die unendliche Banalität deutscher Stadt- und Dorfbilder wirklich durch Kriegszerstörungen mitverursacht wurde. Automobilismus und expansive, aber reflexionsarme Bautätigkeit vernichteten in wenigen Jahren, was in Jahrhunderten gewachsen war. Mangel an Kenntnis und Wertschätzung tradierter Bauformen, das Bedürfnis, alle „Heimattümelei“ zu überwinden und sich modern/international darzustellen, schließlich die in Deutschland dahinschwindende Sensibilität für Architektur wirkten zusammen in einem in der Kulturgeschichte beispiellosen Zerstörungsprozess.
Wieder einmal ist eines Schriftstellers zu gedenken, der leistete, was wir von Feuilleton und Architekturkritik vergeblich erwarten, der uns die Dimension des Kulturverlusts ins Bewusstsein ruft, der im Gefolge von Nazi-Barbarei und 2. Weltkrieg Deutschland heimgesucht hat. Eins unserer Mitglieder machte uns auf den Nachruf auf den jüngst verstorbenen Schriftsteller Peter Kurzeck aufmerksam, den die Wochenzeitung „DIE ZEIT“ veröffentlichte. Wandlung und Verlust waren zentrale in seinen Romanen bearbeitete Erfahrungen, und so thematisierte er auch den Untergang einer Kulturlandschaft im Zeichen von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder: “Zur Chronistenpflicht des Peter Kurzeck gehört auch das Allerfurchtbarste: Festzuhalten, was verschwindet, was vernichtet wird. In unserem allgemeinen Bewusstsein und in der offiziellen Geschichtsschreibung erscheinen die Fünfziger als Aufbaujahre. Dass der so genannte Aufbau und der Fortschritt der Wirtschaftswunderjahre allerdings nur durch Zerstörung möglich waren – das bekommen wir im Vorabend auf vielfache Weise vorgeführt: Die gewachsenen Dörfer werden geordnet und von Neubaugebieten eingekreist, die Bäche begradigt, die alten Witwenhäuschen abgerissen, die Straßen so geebnet, dass man überall „im vierten Gang durchfahren“ kann, eine Formulierung aus dem Roman Oktober und wer wir selbst sind, an die ich nun jedes Mal denken muss, wenn ich mit dem Auto über Land fahre. Was Vorabend erzählt, in immer neuen Anläufen und in immer detaillierter ausgemalten, scheinbar anekdotischen Wendungen, ist in Wahrheit ein Lebensthema: Die Zurichtung eines Landes in Mentalität und Landschaft hin zu einem nach funktionalen und merkantilen Gesichtspunkten straff durchorganisierten System. Eine Komplettneuerfindung binnen weniger Jahrzehnte.“
Vollständiger Text: Nachruf Peter Kurzeck: Die ganze Zeit erzählen, immer
Dr. Harald Streck, Vereinsvorsitzender